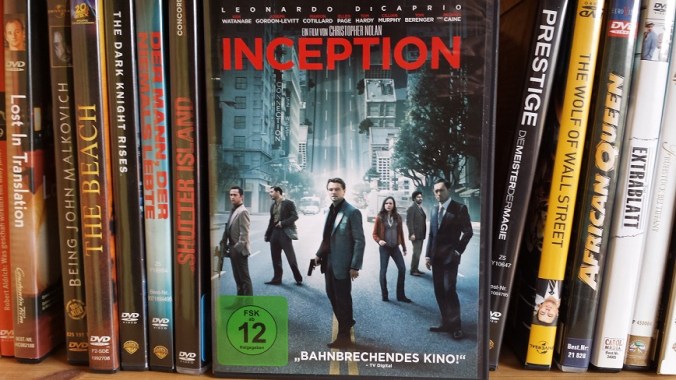
Was passiert, wenn wir träumen? Wir haben übermenschliche Kräfte, fühlen uns wie Superman. Wir meistern Situationen, in denen wir im Alltag versagen. Manchmal können wir sogar fliegen. Es gibt aber auch Träume, die uns in die Abgründe unserer Seele führen, die uns ängstigen, verstören. Was alle Träume gemeinsam haben, ist die Verletzbarkeit des Träumers. Arglos schlafend liegt er da – wehrlos. Was wäre, wenn unsere Träume manipulierbar wären, wenn jemand unsere Gedanken lenken und für seine Zwecke ausnutzen könnte? Wir wären ihm ausgeliefert.
In „Inception“ (2010) spielt Regisseur und Drehbuchautor Christopher Nolan mit dieser Idee und schickt Leonardo DiCaprio auf eine Tour de Farce durch sein Unterbewusstsein. Als Dom Cobb ist DiCaprio so etwas wie ein professioneller Traumdieb. Genauer gesagt kann er sich in die Träume anderer Menschen einklinken und dem Schlafenden Geheimnisse entlocken – seien es brisante Informationen, die Zahlenkombination des Tresors oder der PIN-Code der Oma. Dom und einige Gleichgesinnte haben ihre besondere Fähigkeit zum Geschäftsmodell gemacht. Schwerreiche Sponsoren gibt es zur Genüge. Das Geschäft floriert. Da ist nur ein Haken. Dom lebt und arbeitet im Exil. Er darf nicht zurück in die USA, weil er dort als Mörder auf der Flucht gilt. Sein angebliches Opfer: Mal (Marion Cotillard), seine Frau und Mutter seiner Kinder. Dabei hat sie sich doch selbst aus dem Fenster gestürzt, so glaubt es Dom zumindest.
Leonardo DiCaprio und seine Traumfrau
Was ist hier Schein und was ist Sein? Wo endet die Realität, und wo beginnt der Traum? Ab einem gewissen Punkt sind die Grenzen fließend. Christopher Nolan verlangt seinen Zuschauern bei „Inception“ einiges ab: Konzentration und vollste Aufmerksamkeit. Wir müssen nicht nur zwischen Traum und Realität unterscheiden, sondern auch noch zwischen mehreren Traumebenen. Denn je höher die Anzahl der Traumebenen, desto tiefer gelangt man als Traumtourist in das Unterbewusstsein seines Opfers. Als Hilfestellung hat Christopher Nolan die unterschiedlichen Ebenen so kontrastreich wie möglich gestaltet. So gleiten wir vom verregneten New York in ein nobles Hotel und von dort zu einer verschneiten Festung, wobei die herkömmlichen Gesetze von Raum und Zeit das ein oder ander Mal mächtig auf den Kopf gestellt werden. Optisch meisterhaft umgesetzt.
„Inception“ ist Augenschmaus und packender Thriller zugleich. Und das Beste ist: Man muss Leonardo DiCaprio nicht einmal mögen, um sich mitreißen zu lassen. Sein neuester Fall ist eine harte Nuss. Er soll einen Millionenerben (Cillian Murphy) überzeugen, das Unternehmen seines Vaters abzustoßen. Doch der junge Schnösel wehrt sich mit Händen und Füßen, ist gegen Traumdiebe gerüstet.
Als Dom kämpft Leonardo DiCaprio dabei nicht nur gegen seine Widersacher, sondern auch gegen seine eigenen Dämonen. Ständig taucht Mal in seinem Träumen auf. Sie verfolgt ihn – wie auch das schlechte Gewissen, die Sehnsucht nach ihr und die Überzeugung, die geliebte Frau in den Tod getrieben zu haben. Immer wieder versucht sie ihn davon zu überzeugen, dass seine Realität nur ein Trugbild, eben ein Traum ist, dass er nur aufwachen muss, um wieder mit ihr vereint zu sein. Natürlich ist es nicht Mal, die zu ihm spricht, sondern der Zweifel, der sich in ihm regt. Am Ende gelingt es Dom, sich von Mal zu lösen. Damit begräbt er auch die nagenden Zweifel. Er kehrt nach Hause zu seinen Kindern zurück. Aber ist er wirklich zurückgekehrt, oder träumt er noch? Darüber wird der Zuschauer im Ungewissen gelassen.
Hat euch das Finale auch so verstört? Lebt er am Ende sein Leben oder seinen Traum? Was meint ihr?
Inception (USA, 2010)
148 Minuten
Darsteller: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger, Michael Caine, Ken Watanabe, Lukas Haas, Pete Postlethwaite, Dileep Rao
Regie, Drehbuch: Christopher Nolan
Produktion: Christopher Nolan, Emma Thomas
Kamera: Wally Pfister
Schnitt: Lee Smith
Musik: Hans Zimmer
Mit einem Klick auf meine Facebook-Seite verpasst ihr keinen meiner Beiträge.

